Veranstaltungsskizze: Die Pandemie und die LINKE
Vorbereitungsmaterial für unsere „Quo-Vadis-Die-Linke“ Diskussionsrunde am 05.02.2021
Die Veranstaltung findet als öffentliche Veranstaltung statt. Sie beginnt am 05.02.2021 um 18:30 Uhr. Die Veranstaltung wird als Hybrid-Veranstaltung vorbereitet, an der also sowohl Online, wie auch in Präsenz teilzunehmen ist.
Die Einladung dazu, samt Ortsangabe und Zoom-Daten der Veranstaltung, findest Du hier:
Einladung und Info-Daten Diskussionsrunde 05.02.2021
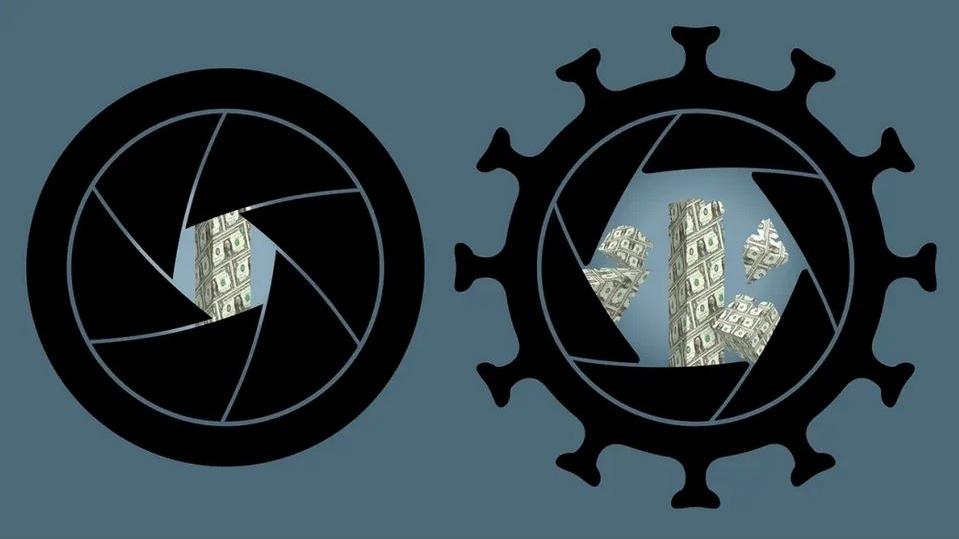
Nach Angaben des RKI sind in Deutschland bis jetzt über 50.000 Menschen mit oder an Corona gestorben. Damit kommen in Deutschland auf 1 Million Einwohner 600 Tote. Deutschland liegt damit weit oben in der Liste jener Länder, in denen besonders viele Menschen im Rahmen dieser Corona-Krise gestorben sind. In Japan sind es auf 1 Million Einwohner 37 Tote. In Kuba 16. In China 3. In Taiwan 0,3. In Neuseeland oder in Singapur sind es 5. Generell gilt: die „Top-10“, also die 10 Länder, die weltweit den höchsten Anteil an Corona-Toten aufweisen, kommen ausnahmslos aus Europa. (Alle Zahlen mit Stand 20.01.2021)
Woran liegt das? In den hiesigen Medien wird mit Blick auf die erfolgreichen Länder eine „andere Mentalität“ der Menschen dort betont. Auch ein lockerer Umgang mit dem Datenschutz. Doch das lenkt nur davon ab, dass die Strategie zur Bekämpfung des Virus in diesen erfolgreichen Ländern inhaltlich eine weitgehend andere ist, als hierzulande. Dort stand die Nachverfolgung (mit oder auch ohne App) von Infektionsherden und deren konsequente Bekämpfung sowie die Neutralisierung von Infektionsgefahren, stets im Mittelpunkt, während es in Deutschland (und Europa) immer nur darum ging die Ausbreitung des Virus abzubremsen.
Konsistenz und Verhältnismäßigkeit der Corona-Maßnahmen wie sie in Deutschland gegeben sind, werden deshalb inzwischen auch hierzulande kritisch diskutiert. Denn während Grundrechte für die Bürgerinnen und Bürger massiv eingeschränkt werden, findet für die Masse Lohnarbeit auch ohne Home-Office jeden Tag statt. Das heißt aber auch: jeden Tag überfüllte Verkehrsmittel im Öffentlichen Nahverkehr, jeden Tag ein neues Infektionsrisiko in Büros und in Fabrikhallen.
Eine stringente Nachverfolgung und Bekämpfung realer Infektionsherde findet indes kaum statt. Dafür gibt es in den Gesundheitsämtern, so berichtete es kürzlich das Hamburger Abendblatt, bis heute noch nicht mal eine geeignete Software. Auch im Sommer geschah so gut wie nichts, um künftige Gefahren einzuschränken. Ganz im Gegenteil: auch 2020 hat sich die Anzahl der Betten in der Intensivmedizin weiter reduziert.
Die Corona-Krise und die internationale Wirtschaftskrise
Die Corona-Krise überschattet eine schwere Wirtschaftskrise. Deren Ursache besteht nicht in der Pandemie, sie wurde aber durch selbige beschleunigt und vertieft. Auch diese Wirtschaftskrise ist eine internationale Krise. Wie tief sie einzelne Länder und Regionen trifft, ist aber von unterschiedlichen Faktoren abhängig. Beispielsweise auch von der Art und Weise wie der Virus in den jeweiligen Ländern bekämpft wird. Aber auch von Verschiebungen im globalen ökonomischen Kräfteverhältnis zwischen einzelnen Regionen und Ländern:
1995 lag der Anteil der 26 führenden kapitalistischen Länder an der weltweiten industriellen Wertschöpfung bei 83,8 Prozent. 2012 waren es nur noch 58 Prozent. Dazu gewonnen haben die so genannten Schwellenländer, darunter vor allem China. Ähnliche Verschiebungen ergaben sich auch für den Welthandel. Trotzdem sind die Schwellenländer nach wie vor sehr stark binnenmarktorientiert. Sie verfügen über dynamische Märkte, die so stark sind, dass sie sowohl einheimische, wie auch importierte Produkte massenhaft aufnehmen können. Auch dies betrifft in besonderer Weise China, das im internationalen Rahmen daher in den letzten Jahren die Rolle einer Konjunkturlokomotive eingenommen hat. Dazu kommt, dass in den führenden kapitalistischen Ländern des Westens der Anteil importierter Vorprodukte an den eigenen Wertschöpfungsketten immer größer wird. Das wiederum betrifft vor allem die Großunternehmen aus dem verarbeitenden Gewerbe, die inzwischen auch technologisch hochwertige Vorprodukte für ihre Waren vielfach in Ausland produzieren lassen, während die inländischen Stammwerke immer weniger in den Genuss von Modernisierungs- oder Ausbauinvestitionen kamen. Um im kapitalistischen Konkurrenzkampf zu bestehen, muss die bestehende Wirtschaftskrise in den Ländern des Westens daher aus der Sicht des Kapitals so gesteuert und reguliert werden, dass eigene Produktionskapazitäten technologisch modernisiert werden, die Vernichtung von überschüssigen Kapital sich indes auf die kleineren und mittelständischen Unternehmen konzentriert, die weniger stark exportorientiert sind. Gleichzeitig sollen zur Standortsicherung die Kosten der Arbeit weiter reduziert werden. Corona bietet für all dies eine geeignete Kulisse.
Die Gründe für die Wirtschaftskrise und das Aufblähen der Finanzmärkte
Kapitalisten als Privateigentümer der Produktionsmittel sind in der Konkurrenz gezwungen, ihr Kapital zu vermehren, d.h. ausgebeuteten Mehrwert zu akkumulieren. Krisen im Kapitalismus sind daher unvermeidlich, weil gesetzmäßig – und im Verhältnis zur kaufkräftigen Nachfrage – immer mehr Kapital akkumuliert wird. Solche Überproduktionskrisen können systemimmanent nur bereinigt werden, in dem die stärkeren Kapitalisten in der Krise Produktions- und Absatzmärkte ihrer schwächeren Konkurrenten übernehmen. Überschüssiges Kapital wird dabei vernichtet. Mit den großen Monopolen und der heutigen Bedeutung des Finanzkapitals hat sich dieser Zustand der Überakkumulation zu einer chronischen Krise verschärft. In der neoliberalen Phase des Kapitalismus wurden durch Privatisierungen zwar immer mehr Bereiche der Gesellschaft kapitalisiert, um so neue Quellen des Profits zu generieren. Neoliberalismus ist aber auch finanzmarktgetriebener Kapitalismus, in dem immer größere Teile der Profitmasse in die spekulativen Bereiche der Finanzmärkte überführt wurden. Realwirtschaftliche Investitionen sind in ihrem Anteil gesunken oder sie stagnieren. Die Gefahren, die von solchen Finanzblasen mit häufig auch „faulen“ Krediten ausgehen ist virulent, so lange nicht staatliche oder sonstige Akteure Finanzmärkte auf Kosten der Allgemeinheit stützen.
Genau das, ist das, was wir gerade erleben: Während in der Krise die Nominallöhne sinken, viele kleinere Unternehmen um ihre Existenz bangen, die Zahl der Erwerbslosen steigt und ganze Länder, wie etwa Italien, in eine Abwärtsspirale geraten, führt die weitere Konzentration von großen Vermögen, zu einem weiteren Aufblähen der Finanzmärkte. Deren Wachstum ist somit unmittelbares Resultat einer beschleunigten Umverteilung von erarbeiteten Reichtum, wie es andererseits aber auch ein Hebel dafür ist, diesen Prozess noch weiter zu beschleunigen. Abgesichert wird dies nicht zuletzt durch staatliche Subventionen für das große Kapital oder die Banken. Auch durch umfangreiche staatlich organisierte Kreditprogramme. Kapitalvernichtung findet indes bei kleineren und mittelständischen Unternehmen statt.
Ähnlich wurde staatlicherseits auch schon 2009 in der Krise agiert. Ein echter realwirtschaftlicher Aufschwung blieb weitgehend aus. Nur mit ihm hätten die „faulen“ Kredite in den Bankbilanzen aber saniert werden können. Da in den hoch entwickelten kapitalistischen Ländern also auch nach der Krise von 2009 realwirtschaftliche Investitionen stagnierten, hat aber auch keine ausreichende Modernisierung, wie sie den Anforderungen des weltweiten Handels entspricht, stattgefunden. Anders indes die Entwicklung in China und auf einigen asiatischen Märkten, die so dynamisch sind, dass sie mindestens auch dem deutschen Kapital immer wieder Entspannung ermöglichte. Deutschland exportierte im Jahr 2000 Waren im Wert von 5 Milliarden Euro nach China. 2007 waren es schon 30 Milliarden, 2019 dann schon Waren im Wert von 90 Milliarden Euro.
Die Grenzen des deutschen Geschäftsmodells
Mit der durch Corona beschleunigten und vertieften Wirtschaftskrise werden die Grenzen dieses Geschäftsmodells, das vor allem auf Exporten sowie auf Anlagen an den Finanzmärkten basiert, nun aber sichtbar. Denn die Exportoffensiven, sowohl innerhalb der EU, wie auch auf dem Weltmarkt, basieren nicht unwesentlich auf Lohndumping, wie er vor allem mit der Agenda-Politik von Kanzler Schröder einsetzte, sich dann aber auch weiter fortsetzte. Die Binnennachfrage zu stärken ist unter diesen Prämissen begrenzt. Eine Verbesserung internationaler Wettbewerbsfähigkeit erhoffen sich Politik und Kapital nun freilich im Rahmen dessen, was man hierzulande Digitalisierungsoffensive nennt. Um sie weiter auszugestalten spielen die etwa 1.5 Billionen Euro die nun in Deutschland unter Corona-Bedingungen entweder als staatliche Subventionierung, oder im Rahmen sonstiger Zuschüsse, bzw. als Kredite, in Richtung des großen Kapitals fließen, eine zentrale Rolle. Weitere Vorteile erhoffen sich die deutschen Groß-Kapitalisten durch technologische Fortschritte bei der Aufrüstung sowie, unter dem Stichwort Klimawandel, dann auch im Bereich moderner Umwelttechnologien. Outsourcing-Strategien in Billiglohnländer, Flexibilisierungsstrategien für den deutschen Arbeitsmarkt und damit einhergehende Reallohnsenkungen bilden für diesen Prozess aber auch weiterhin ein wichtiges Fundament. Kein Wunder also, dass sich Angriffe auf die Arbeitszeiten, auf das Rentenalter, als auch auf gesetzlich vorgeschriebene Arbeitsbedingungen weiter häufen.
Corona bietet für die ökonomische Bereinigung eine gute Kulisse
Corona bietet dafür eine gute Kulisse. Denn wären sonst zum Beispiel 600 Milliarden Euro an staatlichen Zuschüssen für die Großunternehmen so problemlos geflossen? Dazu kommen die Kredite der KfW. Kleinere Unternehmen oder Selbständige erhalten im Vergleich dazu nur Brotkrümel. Angehörige aus der Arbeiterklasse indes nichts. Über letzteres darf das Kurzarbeitergeld nicht hinwegtäuschen. Denn den Sozialkassen entnommen, sichert es zwar einerseits Beschäftigung, andererseits bietet es den großen Unternehmen aber auch ein hohes Maß an Flexibilität im Umgang und im Abwürgen eigener Lohnkosten. Nicht zuletzt dies, wie auch die beabsichtige Verpackung dieses Transformationsprogramms in den Farben eines „Green New Deal“ ergibt zudem den Raum für eine klassenübergreifende Blockbildung, mit der sich die großen Monopole und Finanzkapitale ihre gesellschaftliche Hegemonie ideologisch sichern: „Wir sitzen alle in einem Boot“ und alle gemeinsam müssen jetzt „das Klima retten“, auch wenn letzteres dann vor allem von den Ärmsten der Armen geschultert werden soll.
Die deutsche Variante des gegenwärtigen Lockdowns ist dabei aus der Sicht der großen Kapitale offenbar kein Problem – jedenfalls findet man Protestnoten des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI) dazu bisher nicht. Leiden müssen indes die Lohnabhängigen, die zwar jeden Tag zur Arbeit gehen, aber sonst nicht mehr das Haus verlassen sollen. Leiden müssen kleinere und mittlere Unternehmen sowie Teile des Handelskapitals, und die sich entsprechend über ihre Lobbyorganisationen auch bemerkbar machen. Ansonsten gilt das Versprechen von Bundeswirtschaftsminister Altmeier, dass Deutschland gestärkt aus dieser Krise hervorgehen müsse. Innerhalb der EU, aber auch mit Blick auf die asiatischen Märkte. Deshalb sinken die Nominallöhne. Erwerbslose leiden unter erhöhten Lebenshaltungskosten, sie erhalten aber keine Zuschüsse. Studierende verlieren ihre Nebenjobs. Etliche Gastronomen und Selbständige sowie kleine Unternehmen, fürchten sich vor einer Insolvenz. Nicht zu vergessen: die öffentlichen Betriebe, in deren Haushaltspläne für 2022 schon jetzt entsprechende Kürzungspotentiale eingearbeitet werden.
Die Militarisierung der deutschen Außenpolitik und die Einschränkung demokratischer Rechte
Während der – in seinen Maßnahmen extrem einseitige – Lockdown die Bevölkerung hart trifft, sind gewerkschaftliche und politische Aktivitäten behindert. In Bayern und Hessen sind selbst Parteitreffen mit Hygieneregeln teilweise untersagt – während ein paar hundert Meter weiter tausende zur Arbeit marschieren. Home-Office ist wahrlich nicht die Regel, wie jeder feststellen kann, der sich im Berufsverkehr bewegt. Die gewerkschaftsnahe Böckler-Stiftung bilanzierte im November und Dezember einen Anteil von 14 Prozent, also weniger als die Hälfte dessen, was im Frühjahr schon mal realisiert wurde. Und schauen wir genau hin: auch die jüngste Verordnung des Bundesarbeitsministers dazu ist windelweich. Eklatant sind indes die Einschränkungen im Versammlungsrecht. Auch dann, wenn Demonstrationen unter freien Himmel stattfinden sollen.
Kapitalismus in seiner imperialistischen Phase neigt in solchen Krisen auch immer dazu die außenpolitischen Beziehungen zu militarisieren. Fremde Märkte und neue Einflusszonen sollen verteidigt, ggf. auch erobert werden. EU-Ratspräsidentin Ursula von der Leyen hat deshalb angekündigt, dass in den nächsten fünf Jahren nun „mutige Schritte zu einer echten Europäischen Verteidigungsunion unternommen werden“ müssten.
Ganz unzweideutig: Dieses kapitalistische System stößt an seine inneren Grenzen. Es ist nicht dazu in der Lage, auch nur grundlegende Lebensbedingungen zu gewährleisten. Soziale Absicherung, Wohnen, Gesundheitsversorgung, Bildung, Ernährung, sind für viele Menschen auch in den entwickelten kapitalistischen Ländern nicht mehr garantiert. Aber auch die Grundlagen des Lebens – Umwelt und Klima – werden zerstört. Wie sagten wir es in unserer Erklärung: Das kapitalistische System ist nicht nur selbst in der Krise, es führt zu einer elementaren Bedrohung für das Überleben von Millionen von Menschen.
Für was wir kämpfen sollten
Linke Politik muss Schritte befördern, die in die Richtung eines Ausstiegs aus diesem System orientieren. Die Eigentumsfrage ist dafür die zentrale Schlüsselfrage.
Das beginnt im Gesundheitssektor und der Pharmabranche, wo die Fallpauschalen gestrichen und durch ein System öffentlicher Kontrolle und politischer Zielvorgaben ersetzt werden müssen. Es beginnt mit dem Kampf um Arbeitszeitverkürzungen. Uns auf die Eigentumsfrage zuzubewegen, dafür ist es auch nützlich alles das zu ermöglichen, was die Arbeiterklasse selbst stärkt und die Verfügungsgewalt des Kapitals einschränkt. Also zum Beispiel schärfere gesetzliche Regulierungen für den Arbeitsmarkt, auch für den Bereich Mieten und Wohnen. Das ist dann auch der Weg wie wir beispielsweise auch die Rekommunalisierung der Einrichtungen des Gesundheitswesens zu einem Thema machen können.
Die Eigentumsfrage zu stellen, beginnt also nicht erst, wenn wir die Frage nach einer Enteignung aufwerfen. Sondern viel früher: in jeder Frage, die das Kapital in seiner Verfügungsmacht einschränkt. Und natürlich: dies schließt den Kampf für Abrüstung und den Widerstand gegen Grundrechtseingriffe, wo letztere unverhältnismäßig sind, natürlich mit ein. Und ganz konkret wird es mit der Verfügungsmacht des Kapitals auch dann, dass wenn ein Lockdown stattfinden soll, weil Politik zuvor versagte, dieser als erstes auch den Bereich der Produktion, also abseits aller zwingend lebens-notwendigen Bereiche, einbezieht, ja dass er dort beginnt.
Zur Vertiefung empfehlen wir folgende Artikel:
Übersichten zur Entwicklung der Pandemie in unterschiedlichen Ländern weltweit:
https://www.worldometers.info/coronavirus/
Thesen aus der „Sozialistische Linken“ zum Umgang mit den Corona-Maßnahme-Gegnern:
https://www.freitag.de/autoren/der-freitag/pandemie-und-protest
Die Krankheit heiß Corona, die Krise heißt Imperialismus:
https://www.kaz-online.de/artikel/die-krankheit-heisst-corona-die-krise-heisst-impe
Veränderungen in den ökonomischen Kräfteverhältnissen weltweit (Studie des BDI):
https://bdi.eu/media/presse/publikationen/Studie_Globale-Kraefteverschiebung.pdf
Chinas Wirtschaft auf Wachstumskurs:
https://www.zeit.de/wirtschaft/2020-10/chinas-wirtschaft-erholung-coronavirus-wirtschaftskrise
Interview mit Winfried Wolf.
Insbesondere die Absätze zur Kriegsgefahr, aber auch die zur Corona-Politik:
https://www.heise.de/tp/features/Wir-muessen-harte-Aufklaerungsarbeit-leisten-4849709.html?seite=all
Gedanken von Thomas Sablowski (Rosa-Luxemburg-Stiftung)
Insbesondere den Absatz zur hegemonialen Wirkung deutscher Corona-Politik:
https://www.zeitschrift-luxemburg.de/der-klassencharakter-der-deutschen-politik-in-der-coronakrise/
***
![]() Hier kannst Du dir dieses Vorbereitungsmaterial auch als PDF Datei downloaden. Vielleicht um es dann auszudrucken.
Hier kannst Du dir dieses Vorbereitungsmaterial auch als PDF Datei downloaden. Vielleicht um es dann auszudrucken.
